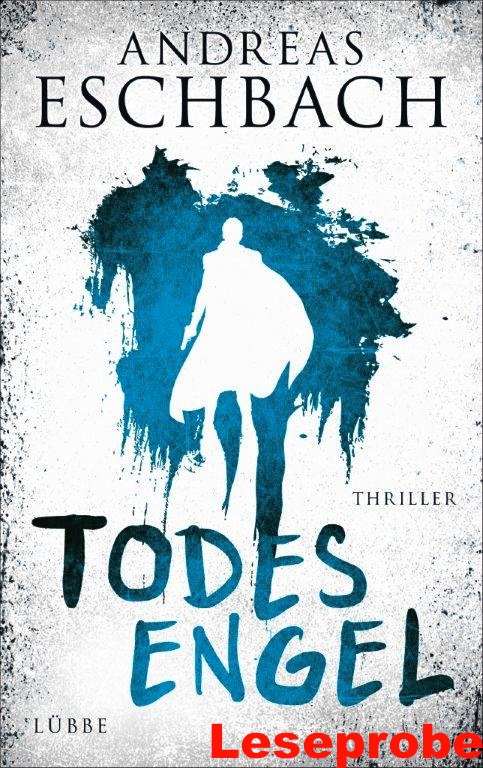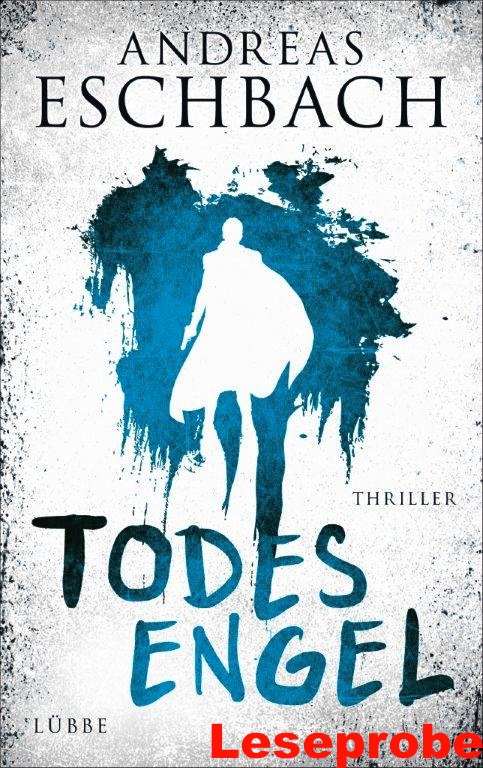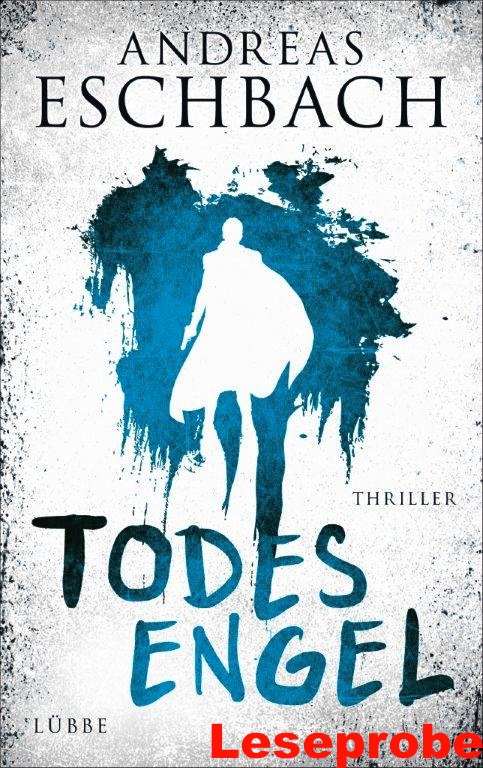
TODESENGEL
Roman
von
Andreas Eschbach
Prolog
Wir Menschen sind sensibler, als die meisten von uns ahnen. Hätten wir keinen Filter im Hirn, die Flut der Sinneseindrücke würde uns überwältigen.
Man kann diesen Filter ausschalten. Ich kann es.
Man sollte es nur tun, wenn man mit der Flut umgehen kann. Auch das kann ich.
Deswegen durchquere ich die Nacht, als bewege ich mich durch einen ungeheuren, lebendigen Organismus. Ich höre die Dunkelheit. Ich fühle die Stimmen Tausender von Menschen. Ich spüre sie atmen, reden, lachen, seufzen. Ich sehe ihre Ängste. Ich rieche ihre Hoffnungen. Ich schmecke ihre Traurigkeit, ihre Verzweiflung, ihre Enttäuschungen.
Ich bin eins mit allem. Das sagt sich leicht, aber kaum einer von denen, die es gesagt haben, hat je gewusst, wovon er redet. Ich weiß es. Ich bin es.
Ich bin auf dem Pfad des Kriegers.
Symphonien flackernder Leuchtreklamen umspülen mich. Scharfkantige Hochhäuser stempeln ihre Silhouetten gegen den nachtfarbenen Himmel. Autos, Taxen, Busse flirren als hektische Interpunktionen, Motorräder sägen in der Ferne, und ich bin der einzige Mensch weit und breit, der zu Fuß geht.
Alles ist ruhig. Aber es ist die Art Ruhe, auf die Stürme folgen. Ich ahne es. Ich spüre es. Ich weiß es.
Ich mache mir keine Gedanken. Ich bin seit Stunden unterwegs, doch ich habe Geduld – nein, ich bin Geduld. Alles wird zur richtigen Zeit geschehen. Es gibt nichts zu beschleunigen, nichts zu bremsen, nichts zu verpassen.
Und es gibt nichts zu entscheiden.
Weil alles längst entschieden ist.
Es ist längst entschieden, dass ich den Abgang einer U-Bahn-Station in genau dem Augenblick erreiche, in dem Schmerz daraus zum Himmel flammt wie ein Fanal, schrecklicher Schmerz und Todesangst.
Auch, dass ich die Treppe hinabsteige, ist längst entschieden.
Ich bin im Zustand der Gnade. Ich werde im richtigen Moment am richtigen Ort sein.
Und das Richtige tun.
1
Zivilcourage! Das Wort lag ihm quer, seit Evelyn es ihm ins Gesicht geschleudert hatte. Was verstand sie schon von diesen Dingen? Seine Schwiegertochter war ein Kind gewesen, als die Mauer gefallen war, und überdies im Westen aufgewachsen: Sie hatte die Zeit damals nicht erlebt.
Ein kalter Herbstwind fegte die Straße herab, schien nach einem Ausgang aus den Häuserschluchten zu suchen. Erich Sassbeck schlug den Mantelkragen hoch und bedauerte es, keinen Schal mitgenommen zu haben. In seinem Alter musste man Erkältungen fürchten.
Außerdem hatte er sich nichts vorzuwerfen. Er hatte nur seinen Dienst getan. Seine Pflicht erfüllt. Die Grenze hatte anti-imperialistischer Schutzwall geheißen, und so ganz falsch war diese Bezeichnung ja auch wieder nicht gewesen, oder?
Wenn man sich so ansah, wie das Leben heute war. Da hatten sie es früher in mancher Hinsicht schöner gehabt.
Aber das durfte man ja auch nicht sagen.
In Sachen Meinungsfreiheit hatte sich doch gar nicht so viel geändert. Es waren nur andere Dinge, die man sagen durfte oder eben nicht. Da sollte ihm keiner was anderes erzählen.
Es herrschte wenig Verkehr. Trotzdem blieb Erich Sassbeck an der Fußgängerampel stehen, wartete, dass sie grün wurde. Ein Taxi hielt; der Fahrer blickte ihn an, als erwarte er, in ihm einen Fahrgast zu finden.
Sassbeck schüttelte unwillkürlich den Kopf. Seine Rente reichte gerade so zum Leben. An Extravaganzen wie Taxifahrten durch die halbe Stadt war im Traum nicht zu denken.
Zum Glück war es nicht mehr weit bis zur U-Bahn-Station. Dort unten würde es wärmer sein.
»Aber hättest du es getan?«, hatte Evelyn insistiert. »Hättest du auf jemanden geschossen, der versucht, zu fliehen?«
Er hatte geantwortet, dass er das nicht wusste. Dass man nicht wissen konnte, wie man in so einer Situation handeln würde, ehe es so weit war.
»Du redest dich raus«, hatte sie sich aufgeregt. »Du hast bloß Glück gehabt. Mit mehr Zivilcourage hättest du gesagt, ich mach das nicht, ich mach diesen Dienst nicht, weil ich nicht auf Leute schießen werde, die nichts Böses getan haben!«
Ihm wurde jetzt noch ganz heiß, wenn er an diesen Streit zurückdachte. Es stimmte; er war froh, nie in eine solche Lage gekommen zu sein. Er hatte ja mitgekriegt, wie es anderen ergangen war, nachdem sie auf Republiksflüchtlinge geschossen hatten. Ein jüngerer Kollege, Rolf aus Karl-Marx-Stadt, hatte eine Frau getötet, die nach Westberlin fliehen wollte. Rolf hatte angefangen zu saufen, geradezu klassisch. Kurz darauf war er versetzt worden, und man hatte nie wieder etwas von ihm gehört.
Endlich, die U-Bahn. Erich Sassbeck seufzte, als er in den warmen Mief eintauchte, der die Treppe heraufkam. Die seltsamen Schmierereien, die auf den ersten Blick aussahen wie eine Inschrift, die man aber nicht lesen konnte, waren immer noch da. Die Stadt hatte es schon lange aufgegeben, der Sprayer Herr werden zu wollen, hatte kapituliert.
Das jedenfalls, dachte Sassbeck und spürte seine Knie wieder, während er die Stufen hinabstieg, hätte es früher nicht gegeben. Und sei es nur, weil niemand Farbe übrig gehabt hätte. Oder wenn, hätten die Leute was Besseres damit anzufangen gewusst.
Noch 12 Minuten, behauptete die Anzeigetafel. Komfortable Sache, das musste man zugeben. Sassbeck studierte trotzdem den Fahrplan im Schaukasten. Die vorletzte Bahn Richtung Stadtmitte. Hatte er sich also richtig erinnert. Beruhigend, dass er sich wenigstens auf seinen Kopf noch verlassen konnte.
Ein lautes Geräusch – ein dumpfer Schlag auf Metall – ließ ihn aufhorchen. Es kam vom Ende des Bahnsteigs, unterhalb der Treppe, die aus dem Mittelgeschoss herabführte. Sassbeck trat ein paar Schritte zur Seite, um zu sehen, was da los war.
Es waren zwei Jugendliche, von denen einer es aus irgendeinem Grund auf eine dort angebrachte Sitzbank abgesehen hatte. Jetzt wieder: Er ging rückwärts, um Anlauf zu nehmen, plusterte sich auf und sprang dann mit voller Wucht gegen die Plastikschalensitze. Diesmal knallte es nicht nur dumpf, man hörte auch etwas brechen.
Der andere Junge stand dabei und schien sich großartig zu amüsieren. Sassbeck verstand nicht, was er sagte, aber es klang, als feuere er seinen Kumpanen an.
Sassbeck wollte sich schon abwenden, als ihm Evelyn wieder einfiel und der Streit mit ihr.
Zivil wie in Zivilisation. Wie in Zivilist.
Courage – das französische Wort für Mut.
Zivilcourage. Der Mut des Bürgers.
Der andere Junge nahm jetzt ebenfalls Anlauf. Die beiden schienen entschlossen zu sein, die Sitzbank zu zertrümmern.
Noch 10 Minuten, stand auf der Anzeigetafel.
Erich Sassbeck gab sich einen Ruck, ging auf die Jugendlichen zu. »He«, rief er, als er nahe genug heran war. »Ihr da. Das tut man nicht.«
Die beiden hörten auf, schauten ihn an, grenzenlose Verwunderung im Blick. Offensichtlich war es lange her, dass ihnen jemand gesagt hatte, was sich gehörte.
»Diese Bank«, fuhr Sassbeck fort, »ist Gemeineigentum. Es ist nicht in Ordnung, das Eigentum aller zu beschädigen.«
Die Sachen, die sie trugen, sahen neu aus und teuer, aber sie passten ihnen nicht, und sie passten auch nicht zusammen. Als hätten sie viel Geld ausgegeben, um hässlich gekleidet zu sein.
»Ey«, sagte der eine, »bist du scheiße im Kopf oder was?« Es klang wie ein Akzent, aber zugleich so, als mache er diesen Akzent nur nach.
»Ich sage nur –«
»Willst du Streit, Mann?«
Sassbeck holte Luft. »Nein. Nein, ich suche keinen Streit. Ich möchte nur, dass ihr das lasst.«
Sie ließen es. Es war unübersehbar, dass die Bank sie nicht mehr interessierte.
Sie kamen auf ihn zu. Er war viel interessanter.
»Ey«, sagte der andere, »meins' du, ich lass mir von alten Knackern was vorschreiben?«
Es klang unangenehm, wie er das sagte.
Es klang richtig gefährlich.
Erich Sassbeck sah sich um. Der Bahnsteig lag verlassen; außer ihm und den zwei Jugendlichen war niemand da. Und er war sechsundsiebzig – zu alt, um davonzurennen.
Sassbeck sah die beiden auf sich zukommen, wollte etwas sagen, etwas, das die Situation wieder entspannte, bis in
8 Minuten
die U-Bahn kam, aber er wusste nicht, was.
Das mit der Zivilcourage kam ihm auf einmal vor wie eine verdammt hinterhältige Falle.
Vielleicht würde er jetzt sterben. Das las man oft in der Zeitung, von Leuten, die in aller Öffentlichkeit zusammengeschlagen wurden und von denen es manche nicht überlebten.
Irmina Shahid sah auf die Uhr, während sie die Treppe zur U-Bahn hinabeilte. Doch, die Bahn würde sie noch kriegen. Gut. Es wäre auch zu peinlich gewesen, wenn sie ihre Freundin noch einmal hätte herausklingeln und um Geld für ein Taxi bitten müssen, um nach Hause zu kommen.
Sonst nahm sie immer die Bahn eine halbe Stunde früher, nicht die letzte. Die jetzt würde nur bis zur Wendeschleife hinausfahren und dann noch einmal stadteinwärts ins Depot. Die Lumpensammler-Fahrt. Da hockten oft seltsame Gestalten in den Wagen, und man erlebte bisweilen unerfreuliche Dinge. Doch sie hatten sich seit Claires Operation nicht gesehen und einander viel zu erzählen gehabt.
Am unteren Ende der Treppe, in dem Gang, der vorne auf den Bahnsteig führte, hörte sie ungewöhnliche Geräusche. Sie blieb stehen, lauschte angespannt. Da schrie jemand. Zwei Leute, die Schreie ausstießen, deren Aggressivität einen erschaudern ließ. Dazu dumpfe Schläge, wieder und wieder.
Auch das noch. Eine Prügelei.
Irmina Shahid überlegte. Am liebsten hätte sie sich umgedreht und wäre wieder gegangen, letzte Bahn hin, letzte Bahn her. Sie zog es vor, derlei hässlichen Dingen aus dem Weg zu gehen.
Andererseits war das nicht richtig. Wenn alle so handelten, war es kein Wunder, dass solche Dinge immer öfter vorkamen.
Ihr Blick blieb wie von selbst auf einem uralten, schmierig aussehenden Notrufkasten hängen. Sie konnte die Polizei rufen. Ungern, weil sie aus Erfahrung wusste, was das für Unannehmlichkeiten nach sich zog, aber das war etwas, das sie tun konnte.
Jetzt hörte sie auch jemanden stöhnen.
Sie schlich an der Wand entlang, die von oben bis unten vollgeklebt war mit Konzertplakaten, Wohnungsgesuchen und Ankündigungen von Flohmärkten. Vorne angekommen spähte sie behutsam um die Ecke.
Tatsächlich. Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig traten zwei Jugendliche auf einen alten Mann ein, der am Boden lag, die Hände vor dem Kopf, und nur noch zuckte, wenn ihn die Stiefel trafen. Sie hörten nicht auf, schrien und traten, schrien und traten …
Irmina Shahid fuhr zurück, lehnte sich für einen Moment gegen die Wand. Ihr Herz schlug auf einmal wie wild. Gewiss, die Geleise lagen zwischen ihr und den beiden Schlägern, aber was hieß das schon?
Sie musste etwas tun. Sie griff in ihre Handtasche, kramte darin und zog ihr Handy heraus.
So also würde er sterben. Das war alles, was Erich Sassbeck denken konnte. Dass dies sein letztes Stündlein war, wie man so sagte.
Auch wenn er sich das freilich anders vorgestellt hatte.
Sie traten auf ihn ein, schrien ihn an, bespuckten ihn. Er schmeckte sein eigenes Blut, spürte seine Rippen brechen unter ihren Tritten. Sie waren außer sich, übten keinerlei Zurückhaltung. Dass er alt und gebrechlich war, schienen sie überhaupt nicht wahrzunehmen, geschweige denn, dass es sie gebremst hätte. Erich Sassbeck lag am Boden, sah ihre Fußtritte kommen und ihre wutverzerrten Gesichter und begriff nicht, wie so etwas möglich war. Sie tobten eine Wut an ihm aus, deren Ursache er unmöglich sein konnte, und sie taten es ohne jedes Mitgefühl und ohne einen Rest von Menschlichkeit. Er hatte aufgehört, um Hilfe zu schreien, und er winselte auch nicht mehr um Gnade. Er wartete nur noch darauf, dass es endlich vorbei war.
Doch da, genau in dem Moment, in dem er mit seinem Leben abgeschlossen hatte, geschah etwas. Etwas, mit dem Erich Sassbeck noch weniger gerechnet hätte als mit einem solchen Ende.
Er sah einen Engel.
Es war ein Wunder. Es war eine Erscheinung. Es konnte unmöglich wahr sein. Ein strahlend weißer Engel war lautlos hinter den beiden tobenden Jugendlichen erschienen, die ihn nicht bemerkten, sondern weiter schrien und zutraten, bloß dass ihre Tritte und Schreie auf einmal wie im Nebel zu verschwinden schienen.
Erich Sassbeck war zutiefst erschüttert von diesem Anblick. Er war im Geist des Marxismus-Leninismus erzogen worden, hatte Religion stets als Opium fürs Volk betrachtet und erwartet, mit dem Tod einfach zu verlöschen. Niemals hätte er geglaubt, am Ende seines Lebens ausgerechnet einem wahrhaftigen Engel zu begegnen.
Aber der Engel war da. Sassbeck sah ihn so deutlich vor sich wie die Pfeiler, die die Decke der U-Bahn-Station stützten, so deutlich wie die Anzeige, die gleichmütig verkündete: Noch 3 Minuten. Der Engel sah aus wie ein schlanker, schöner, ernster junger Mann. Sein Blick war kühl und, seltsamerweise, gnadenlos. Er trug ein weites, von innen heraus in strahlendem Weiß leuchtendes Gewand, und er hatte lange, weiße Haare, die ein Luftzug wehen ließ und die ebenfalls leuchteten wie illuminiert.
Erich Sassbeck spürte die Tritte seiner Peiniger kaum noch. Er hatte nur mehr Augen für die Erscheinung. War der Engel gekommen, um ihn abzuholen? Würde er sich nun zu ihm hinabbeugen, um seine Seele zu bergen und mitzunehmen in eine bessere Welt?
Der Engel tat nichts dergleichen. Stattdessen hob er die Arme, in jeder Hand eine Pistole, und schoss die beiden jugendlichen Angreifer in den Kopf.
|