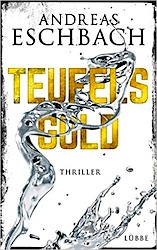
TEUFELSGOLDRoman |
Die Rüstung, die weinte
Es begab sich im Jahre des Herrn 1295, dass Knappen des Ritters Bruno von Hirschberg in dessen Wäldern, genauer an der Furt, die über den Fluss führte, auf einen einsamen Reisenden trafen. Ein armseliger Wagen stand schief inmitten des schimmernden Stromes, als sie des Weges kamen, und auf dem Kutschbock saß ein grauhaariger Mann, der fluchend mit seiner Peitsche auf das davorgespannte Pferd einschlug. Dessen Fell glänzte schon vom Schweiß, doch so sehr es sich, kläglich wiehernd, ins Geschirr legte, der Karren stak im Kies des Flussbettes fest und rührte sich nicht von der Stelle. »He-ho!« rief einer der Schildknappen, ein Mann namens Egbert, und preschte mit seinem Pferd in die Furt. »Können wir Euch helfen, Fremder? Mir scheint, Ihr habt es schlecht getroffen.« Die anderen Reiter folgten ihm, fünf an der Zahl, junge und kräftige Burschen. Der Mann auf dem Kutschbock senkte die Peitsche und wandte sich den Reitern zu. Graues, ungepflegtes Haar und ein filziger Bart rahmten ein Gesicht, in das Zeit und Wetter tiefe Furchen gegraben hatten. Gekleidet war er in ein grobes Gewand aus Sackleinen, das alt und zerschlissen aussah, ebenso wie der Wagen, den er fuhr. Allein seine Augen waren nicht die eines gewöhnlichen alten Mannes – ein merkwürdiges Feuer loderte in ihnen, eine argwöhnische Wachsamkeit, wie sie Verfolgte zeigen, die seit Jahren auf der Flucht sind. Holla!, dachte Egbert bei sich. Er hatte seinen Herrn auf dem letzten Kreuzzug begleitet, und sein Instinkt, der sich auf dieser gefahrvollen Reise bewährt hatte, warnte ihn, dass es mit diesem Mann eine besondere Bewandtnis haben musste. »Eines der Räder ist eingesunken«, sagte der Fremde mit einer Stimme, die brüchig klang und doch, als sei sie in Wahrheit aus Eisen. »Wenn Ihr mir helft, es freizubekommen, kann ich meine Fahrt wohl ohne Schwierigkeiten fortsetzen.« Egbert nickte den anderen zu, und sie sprangen von ihren Pferden in den Fluss. Das Wasser reichte ihnen bis zu den Hüften und umströmte sie kalt und nass, als sie sich gemeinsam gegen den knarrenden Holzkasten stemmten. Der alte Mann ließ wieder die Peitsche sprechen, sie drückten und stöhnten und spornten sich gegenseitig an und bekamen das Rad schließlich frei. »He-ho!« rief Egbert noch einmal und watete rasch zu seinem Pferd, griff nach dessen Zügeln und schwang sich zurück auf den Sattel, um eilig dem Gespann zu folgen, das rumpelnd quer durch die Strömung fuhr und sich daranmachte, das Ufer zu erklimmen. Es war Egbert nicht entgangen, wie unerhört schwer der Wagen gewesen war. Kein Wunder, dass seine Räder eingesunken waren in dieser Furt, die sonst die größten Handelstrosse ohne Weiteres passierten. »Fremder!«, rief er dem Wagen nach, als der wieder trockenes Land unter den Rädern hatte, und winkte seinen Begleitern, rasch aufzuschließen. »Wer seid Ihr, und wohin wollt Ihr?« »John Smith ist mein Name«, gab der Reisende zurück, ohne anzuhalten, »und ich bin Angelsachse, auf dem Weg nach Hause!« Egbert holte ihn ein und ritt neben ihm her, auf der Höhe des Kutschbocks. »Seid Ihr ein Bader?« »Nein.« »Ihr fahrt einen Wagen, wie Bader ihn fahren.« »Ich habe ihn von einem Bader gekauft, aber ich bin kein Bader. Ich bin nur ein Reisender.« »Und woher kommt Ihr, John Smith?« Der alte Mann, der sich John Smith nannte, warf ihm einen unwilligen Blick zu. »Aus dem Süden.« »Wollt Ihr uns nicht erzählen, woher?« beharrte Egbert und sah sich nach seinen Kameraden um. »Was geht Euch das an?«, fragte der Fremde zurück. Da hieb Egbert seinem Pferd in die Seiten, sprengte voran und versperrte dem Gespann den Weg. Zornig straffte der alte Mann die Zügel, aber sein Pferd blieb ohnehin mit bebenden Flanken stehen. »Was soll das?«, rief er mit funkelnden Augen. »Ihr seid uns noch einen Dank schuldig«, erklärte Egbert, während sich die anderen zu ihm gesellten und sich auf sein Kopfnicken hin um den Wagen des Fremden verteilten. »Wir haben Euch geholfen, aber Ihr seid einfach weitergefahren ohne ein Wort des Dankes.« »Also schön«, knurrte der Reisende. »Ich danke Euch.« Egbert schüttelte den Kopf, und er tat es ganz langsam. Wer ihn kannte, wusste, dass dies eine Drohung war. »Ihr werdet uns begleiten, John Smith. Unser Herr wird es interessant finden, Eure Bekanntschaft zu machen.«
Ritter Bruno von Hirschberg war ein Mann, der rund und gemütlich wirkte, solange er still dasaß. Bewegte er sich jedoch, merkte man ihm ein feuriges Ungestüm an, eine brennende Ungeduld, die ihn vorantrieb. Er kannte wenig Nachsicht mit seinen Untergebenen, hetzte die Diener unentwegt, war den ganzen Tag rastlos unterwegs, Befehle bellend, als würde er von tausend Geistern gehetzt und als stünden die Sarazenen vor den Toren der Burg. Auch des Nachts, so erzählte man sich, war er rastlos, und so trug seine Gemahlin, die ihm in den Jahren des Kreuzzugs treu gewesen war, endlich ein Kind unter dem Herzen, von dem die Wahrsagerinnen weissagten, dass es ein Sohn werden würde. Normalerweise nahm Ritter Bruno von niemandem einen Rat entgegen, am allerwenigsten einen Rat, was er tun oder lassen sollte. Einzig auf seinen Schildknappen Egbert hörte er, ab und zu wenigstens. So kam es, dass der Ritter, sein Schildknappe und sein Medicus, ein Bär von einem Mann namens Mengedder, hinter einem der Fenster des Burgturms standen und hinabsahen auf den Burghof, in dessen Mitte das kuriose Gespann des Fremden wartete. »Habe ich nichts Besseres zu tun, als mich um jeden Reisenden zu scheren, der meine Ländereien durchquert?«, schnaubte Bruno aufgebracht. »Unterdessen schaffen meine Bauern ihre halbe Ernte beiseite und betrügen mich um den Zehnten.« »Mit diesem da hat es etwas auf sich, Herr«, meinte Egbert ruhig, der solchen Ton gewöhnt war. Der Medicus spähte lustlos hinunter auf den Fremden, der schief auf seinem Kutschbock saß und seinem Pferd zusah, wie es an einem Büschel Heu fraß. »Was soll es mit dem wohl auf sich haben?«, brummte er. »Ein alter Angelsachse mit unfreundlichen Manieren. Na und?« »Als wir seinen Wagen aus der Furt befreiten, fiel mir auf, dass er so schwer war, als sei er vollgeladen mit purem Eisen. Seht Ihr, wie zerschunden das arme Pferd ist? Es ist kaum zu glauben, dass es allein eine solche Last zu ziehen vermag.« »Was ist so seltsam an einer schweren Last?« Egbert sah den Ritter an, als er antwortete. »Ich habe einen Blick hinein getan in den Wagen«, sagte er ernst. »Und das Seltsame ist: Er ist so gut wie leer. Ich sah ein paar Kleider, ein paar Vorräte, eine Tasche und eine kleine Kiste – das war alles!« Bruno machte zischende Geräusche mit den Zähnen. »Und du sagtest, es sei etwas in seinem Blick?« »Ja«, erwiderte der Schildknappe und nickte. »Er schaut drein wie einer, der Verfolger hinter sich weiß.« »Ihr denkt, er hat ein Verbrechen begangen?«, fragte der Medicus. »Ich bin mir nicht sicher«, gestand Egbert. »Es könnte auch sein, dass er einen Schatz erbeutet hat, den er nach Hause bringen will.« Der Ritter schnaubte triumphierend. »Vielleicht ist es der Wagen selber, der so schwer ist«, überlegte er laut. »Mag sein, dass er nur so aussieht, als sei er aus Holz.«
Sie lockten den misstrauischen Fremden von seinem Gespann fort, indem sie vorgaben, ihm ein Gemach zuweisen zu wollen, in dem er sich ausruhen könne, bis der Burgherr ihn zu sprechen wünschte. Doch kaum war der Mann mit seinem Begleiter in der Tiefe der Burg verschwunden, machten sie sich über den Wagen her, stießen mit ihren Messern in die Holzlatten und hoben die Dielen des Wagenbodens an, um zu sehen, ob etwas darunter sei. Wie sich rasch herausstellte, war der Wagen tatsächlich aus Holz, aus altem, brüchigem Holz noch dazu – es würde heikel werden, dem Angelsachsen die Beschädigungen an seinem Karren zu erklären. Was so unerhört schwer war, war die kleine Kiste. Egbert hatte sie herausziehen wollen, allein, er vermochte die Kiste, die kaum so lang war wie ein Unterarm und kaum so hoch wie ein Stiefelschaft, nicht von der Stelle zu bewegen. Zuerst glaubte er, sie sei festgenagelt, aber unter Aufbietung aller Kräfte zog er sie doch eine Handspanne fort, und da wusste er, dass er den Schatz gefunden hatte. Er holte einen seiner Kameraden zur Hilfe, einen jungen, starken Burschen namens Arved, und gemeinsam mit zwei weiteren Männern brachten sie glücklich die schwere Kiste aus dem Wagen und auf den Boden des Burghofs. »Bei Gott«, rief Arved aus, »dieses Ding muss inwendig mit purem Gold gefüllt sein.« Und er versuchte, den Deckel zu öffnen, doch der war verschlossen. Wer den Schlüssel zu der Kiste bei sich trug, war nicht schwer zu erraten. Egbert kniete sich nieder und studierte die Kiste. Bei Tageslicht sah man, dass sie saubere Schreinerarbeit war, aus hellem, festem Holz gemacht und an allen Ecken mit stählernen Beschlägen versehen. Dass der Deckel durch ein eingebautes Schloss gesichert war, versprach wertvollen Inhalt. »Wir werden den Angelsachsen zwingen, sie zu öffnen«, beschloss der Schildknappe und erhob sich. »Und das falsche Spiel mit ihm können wir beenden.« Er gab einem der Burschen einen Wink. »Geh und hol den Fremden her. Und sag, dass ich es angeordnet habe.« Der Bursche rannte los. »Was brauchen wir den Angelsachsen?«, meinte Arved geringschätzig. »Sollten wir so ein Schloss nicht leicht selber aufbekommen?« Und er zückte sein Messer. Egbert beschlich ein Gefühl drohender Gefahr, als Arved anfing, mit seinem Messer an der Kiste herumzufuhrwerken. Er sah sich um, sog witternd die Luft des späten Nachmittags durch die Nase und roch doch nur Küchendünste, Schweiß, Staub und Fäkalien. Er blickte hoch zu den Zinnen der Burg, sah die Wachen stehen, wie immer. Und trotzdem … »Ein verteufeltes Schloss«, schimpfte Arved. »Wer das gebaut hat, versteht etwas vom Schlosserhandwerk …« Die Kiste. Es hatte mit der Kiste zu tun. Doch was konnte schon gefährlich sein an einer Kiste? »Lass sie in Ruhe«, sagte Egbert, obwohl er wusste, dass Arved nicht auf ihn hören würde. Dabei musste jeden Augenblick der alte Mann zurückkommen, und sie würden ihn heißen, ihnen den Inhalt der Kiste zu zeigen. »Ich hab den Riegel getroffen, glaube ich«, verkündete Arved, der verbissen mit der Spitze seines Messers in der dünnen Ritze zwischen Deckel und Kasten hantierte. »Oha! Und auf ist sie!« »Nicht!«, schrie da eine Stimme vom Haupthaus her. »Nicht die Kiste!« Egbert fuhr herum. Der alte Angelsachse. Mit wehenden Haaren kam er angestürzt, offensichtlich außer sich vor Entsetzen. Die Gefahr! Also doch … »Arved!«, rief der Schildknappe. »Lass sie zu!« Und er stürzte nach vorn, um den Kameraden zu hindern. Aber er kam zu spät. Keiner von ihnen würde jemals im Leben vergessen, was sich ihren Augen darbot: Arved lüftete den Deckel der Kiste, nur einen Daumen breit – doch schon aus diesem winzigen Spalt schoss ein Strahl grellen, weißen Lichts hervor, heller als die Sonne am Himmel, gleißender als alles Gold im Palast der Königin von Saba … Arved, der ahnungslos mitten hineingeblickt hatte in dieses Licht, das so hell war wie das Antlitz Gottes, schrie auf, ließ los und fiel schreiend hintenüber, schreiend wie ein Tier, die Hände vor die Augen gepresst. Der Deckel klappte zu, und das Erlöschen des Lichts ließ den hellen Tag ringsum auf einmal dunkel aussehen. »Narren!«, donnerte der Angelsachse. »Narren! Was habt ihr an meinem Wagen zu schaffen, ihr nichtsnutzige Bande von Wegelagerern …?« Egbert erwachte aus seiner Starre. Egal, was dies alles zu bedeuten hatte, es musste gehandelt werden. »Soldaten, zu mir!«, befahl er und reckte sich, damit jeder sah, wer dies rief. Den ersten beiden Waffenmännern gebot er, auf den Angelsachsen zeigend: »Nehmt diesen Mann fest und bringt ihn ins Verlies!« Und während der Fremde protestierend abgeführt wurde, ließ er die anderen Soldaten einen weiten Kreis rund um den Wagen, das müde Pferd und ihren grausigen Fund bilden: »Dass mir niemand in die Nähe der Kiste kommt!« Arved schrie nicht mehr, er wimmerte nur noch, und sein Atem ging röchelnd. Die Hände hatte er immer noch vor den Augen, und ein immer stärker werdendes Zittern beherrschte seinen Körper. Egbert drängte die Kameraden beiseite, die sich um den Jungen bemühten, kniete bei ihm nieder und beugte sich über ihn. Arved schien fast wahnsinnig vor Schmerz. Behutsam griff Egbert nach Arveds Händen, versuchte vergebens, sie ihm vom Gesicht wegzuziehen. Die Gesichtshaut war rot, wie von der Sonne verbrannt, und begann sich zu schälen und aufzuplatzen. Man musste ihm nasse Tücher auflegen, Heilerde aufbringen … Er durfte sich nicht das Gesicht durch den Druck seiner Hände zerstören, schon um der Frauen willen nicht, deren Herzen für ihn schlugen. »Holt Mengedder«, sagte Egbert, zu niemand Bestimmten, und es genügte ihm, daraufhin eilige Schritte zu hören. Er packte noch einmal die Hände Arveds. Diesmal ließ Arved zu, dass er sie beiseite zog, und als Egbert sein Gesicht sah, wusste er, warum der Junge sich gewehrt hatte. Er wusste auch, dass hier kein Medicus mehr helfen konnte. Er hatte viel gesehen während der Schlachten gegen die Heiden, doch dies hier ließ selbst ihn würgen. Die Augen. Arved hatte keine Augen mehr. Was einmal seine Augen gewesen waren, rann ihm als schleimige Gallerte aus den Höhlen. |
|
Roman von Andreas Eschbach Bastei-Lübbe, Köln ISBN 978-3-7857-2568-9 Erscheint am 9. 9. 2016 |