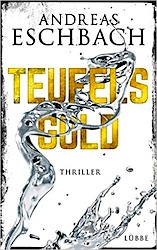
TEUFELSGOLDRoman |
|
Sie verhörten den Fremden im Großen Saal. Sie hatten die Tische zu einem Geviert zusammengestellt, in dessen Mitte der geheimnisvolle Reisende stand. Im Schein der Kerzen und des Feuers im Kamin sah sein Gesicht dämonisch aus und sein Bart wie der eines Zauberers. »Ich bedaure, was geschehen ist«, erklärte er zum wiederholten Male, »aber niemand hat ihn geheissen, Hand an meinen Besitz zu legen.« Der Ritter saß in seinem hohen Lehnstuhl, wie es seiner Würde gebührte, doch er hatte eine Hand um den Knauf der Lehne geschlossen, und diese Hand bebte, so fest presste er das Holz. »Wer seid Ihr?«, fragte er, auch zum wiederholten Male. »Und was ist das in dem Kasten?« Der fremde Reisende blickte ihn müde an. »Es ist ein Fund, den ich getan habe. In dem Kasten liegt ein leuchtender Stein, so groß wie eine Männerfaust und so schwer wie ein ganzer Mann; ein Stein, der eines Nachts vom Himmel fiel unweit der Stelle, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte. Als ich mich ihm näherte, sah ich, dass Vögel, die in seine Nähe kamen, tot zu Boden fielen. Ich sah Mäuse daneben verenden und das Gras verdorren. Ich fand schließlich, dass man sich dem Stein einzig unter dem Schutz von reinem Blei nähern kann, und deswegen ist der Kasten inwendig aus Blei gemacht und so schwer. Es war eine Narretei, ihn leichtfertig zu öffnen«, schloss er grimmig. »Und was wollt Ihr mit diesem gefährlichen Stein?«, begehrte Bruno von Hirschberg zu wissen. »Hätte ich ihn liegen lassen sollen?« Alles sah auf, als sich in diesem Moment das schwere Hauptportal knarrend öffnete und Mengedder eintrat, der Medicus, einen dicken Folianten unter dem Arm und Trübsinn im Blick. »Gott in seiner Gnade hat Arved zu sich geholt«, erklärte er grollend und hustete. »Es gab nichts mehr, was man hätte tun können.« Unter den Anwesenden entstand Unruhe. Man bekreuzigte sich und murmelte Gebete. Das Licht der Kerzen schien dunkler zu werden. »Sagt mir, Angelsachse«, fragte Mengedder, während er an einen der Tische trat und das Buch vor sich hinlegte, »aus welchem Grund führt Ihr ein so teuflisches Mineral mit Euch auf Euren Reisen?« Der Fremde sah ihn misstrauisch an. »Das ist schwer zu erklären«, meinte er dann. »Vielleicht könnte man sagen, aus Neugier?« »Ah, aus Neugier!« wiederholte der Medicus und schlug wie nebenbei den Einband des Folianten auf, den er mitgebracht hatte. »Da Ihr Neugier offenbar für eine schätzenswerte menschliche Eigenschaft haltet, werdet Ihr mir sicher verzeihen, dass ich noch einmal bei Eurem Wagen war und mir erlaubt habe, in Euren Aufzeichnungen zu lesen …« Der bärtige Reisende kniff die Augen zusammen, dass sie funkelten, und zischte einige schier unverständliche Laute. »Aber, aber, das war ein Fluch! Ein lateinischer zwar, und ein interessanter dazu, aber ein Fluch«, mahnte Mengedder. »Und seid gewiss, dass ich des Griechischen ebenso mächtig bin.« Er blätterte mit grimmiger Gelassenheit die ersten, eng beschriebenen Seiten um. »Es war zweifellos klug von Euch, Euren richtigen Namen zu verschweigen, denn sonst hätte ich schon viel früher Verdacht geschöpft.« »Heraus mit der Sprache, Mengedder!«, drängte Bruno von Hirschberg. »Was habt Ihr herausgefunden?« »Ich lese hier von Transmutationen und Ammoniak, von den fünf Elementen und den antagonistischen Kräften, von Amalgamen und Sulfuren und von getöteten und wiederbelebten Metallen. Ich finde ganze Seiten, die abgeschrieben sind aus Werken Al'Razis und des Zosimos von Panopolis. Dieser Mann, Herr, ist tatsächlich Angelsachse. Jedoch ist sein Name nicht John Smith, sondern John Scoro, und er ist ein Alchemist, dessen Name bekannt ist in Kreisen der Gelehrten. Das, was er in seinem Kasten mit sich führt und was dem armen Arved zum Verhängnis wurde, ist nichts anderes als der Stein der Weisen.«
|
Kapitel 2
Allerhand, dachte Hendrik und klappte das Buch zu, um es einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Es handelte sich um ein ausgesprochen schmales Bändchen, in festen, leinenbezogenen Karton gebunden, mit einer Art Wappen mit einem schlichten Kreuz auf der Vorderseite und der Ziffer 1 auf dem Rücken, in Gold geprägt, das allerdings schon reichlich abgegriffen wirkte. Auf der Rückseite Reste eines Aufklebers: Collec … Ott … ließ sich noch entziffern. Auf dem Deckblatt stand unter dem Titel Band 1, weiter unten Gedruckt 1880, sonst nichts – kein Verlag, kein Autor, keine anderen Informationen. In der rechten unteren Ecke fand sich ein uralt aussehender handschriftlicher Vermerk, zwei Zahlen: 21/20. Das war nicht der Preis, oder? Hendrik schob sich an zwei staubigen Kartons vorbei und machte sich auf die Suche nach dem Antiquar. Der stand an dem Schreibtisch im vorderen Teil des Ladens und telefonierte gerade, in einem Schwyzerdütsch, von dem Hendrik kein Wort verstand. Er war ein gutes Stück jünger als Hendrik, Mitte zwanzig vielleicht, trug ein kleinkariertes, blassrosa Hemd mit einem abgewetzten Kragen, der ihm zu eng war, und hatte Pickel. Endlich beendete er das Gespräch, knallte den schwarzen Hörer auf das ebenfalls äußerst antiquarisch wirkende Telefon und fragte barsch: »Ja?« »Das hier«, sagte Hendrik und reichte ihm das Büchlein. »Was soll das kosten?« »Das steht immer auf dem –« Er hielt inne, das Buch in Händen, bekam auf einmal große Augen. »Woher haben Sie das?« »Das lag da hinten auf –« »Das ist nicht zu verkaufen«, schnappte der Antiquar. »Das ist bereits für einen Kunden reserviert.« Er drückte das Buch an sich, als befürchte er, Hendrik könne es ihm entreissen, und machte eine ausholende Geste mit der freien Hand. »Bei den anderen Büchern steht der Preis auf dem Deckblatt. Rechts oben, mit Bleistift.« Damit ließ er Hendrik stehen und marschierte, das Buch an der Brust gesichert, zurück in den hinteren Ladenraum. Dort stand noch ein Schreibtisch, ein wurmstichiger Sekretär, über und über mit betagten Druckwerken vollgestapelt wie jede freie Fläche in diesem Antiquariat. Hendrik folgte ihm, sah verdattert zu, wie der Mann aus einer überquellenden Schublade einen wattierten Briefumschlag zerrte, in den er das Buch hineinstopfte. In dem Moment klingelte erneut das Telefon. Der Antiquar gab einen Laut von sich, der wie »Chogä!« klang, klatschte den Umschlag auf einen der Stapel und hastete wieder nach vorne. Hendrik wandte sich den Regalen zu. Schade, er hätte zu gerne gewusst, wie die Geschichte weiterging. Er spähte aus dem Fenster des im Souterrain gelegenen Antiquariats, sah dann auf seine Armbanduhr. Der Regenschauer, der ihn hereingetrieben hatte, schien vorüber zu sein, doch sein Zimmer im Hotel war bestimmt immer noch nicht bezugsbereit. Die Müdigkeit, die ihm in den Knochen saß, hatte einen Punkt erreicht, an dem sie ihn spürbar aggressiv machte. Das würde hoffentlich bis zum Beginn des Seminars vergehen, aber jetzt gerade hätte er seinen Chef auf den Mond schießen können. Um halb vier Uhr morgens war er aufgestanden, um den ersten Flug nach Zürich zu erwischen, und einzig aus dem Grund, weil das der billigste war! Hendrik zog aufs Geratewohl weitere Bücher aus den Regalen, las die Titel, um sich abzulenken. Böhmische Sagen und Märchen. Baltische Schicksale im Spiegel der Geschichte einer kurländischen Familie 1756 bis 1919. Friedrich Förster, Ausführliches Handbuch der Geschichte, Geographie und Statistik des Preussischen Reichs – zweihundert Franken sollte das alte Buch kosten, allerhand! Oder hier: Ernst Willkomm, Wanderungen an der Nord- und Ostsee, aus dem Jahre 1850, aber erstaunlich gut erhalten. Hendrik schob den Band zurück ins Regal, atmete tief durch. Es roch nach Staub und vergilbtem Papier und von draußen nach feuchtem Asphalt. Er hörte die eiligen Schritte von Passanten, Motorengeräusch, das Gurgeln von Wasser in Gullis. Und den Antiquar, der immer noch telefonierte. Hendrik sah den Briefumschlag an, der auf dem Sekretär lag. Unverschlossen. Auf einmal fand er den Gedanken, dass er nie im Leben erfahren sollte, wie die Geschichte um den Angelsachsen und dessen geheimnisvollen Stein weiterging, unerträglich. Geradezu empörend. Infam. Eine Ungerechtigkeit des Schicksals, die zum Himmel schrie. Das Telefonat wurde auf Französisch geführt, Hendrik verstand kein Wort. Aber es klang irgendwie, als würde es noch eine Weile dauern. Hendrik ging das Regal ab, zog ein Buch heraus, das dem im Umschlag in Größe und Farbe ähnelte: Braune, Gotische Grammatik stand auf dem Rücken. Auch in Gold geprägt. Gedruckt in Halle, 1887. Harter, dunkelbrauner Leineneinband. Nicht identisch, aber ähnlich genug. Es waren nur drei rasche Schritte bis zum Schreibtisch. Nur eine kühne Bewegung, das eine Buch herauszuziehen und in die Regenjacke zu stecken, das andere an seiner Stelle in den Umschlag zu schieben. Dann die Jacke zugezogen, damit das gestohlene Buch an seinem Platz blieb, und los. Aber langsam. So, als wenn nichts wäre. »Auf Wiedersehen«, sagte Hendrik zu dem Antiquar im rosa Hemd. Der sah auf, ohne den Gruß zu erwidern, musterte ihn argwöhnisch, dem Hörer in seiner Hand lauschend. Hendrik spürte sein Herz bis in den Hals herauf schlagen, während er die bimmelnde Tür aufzog und die drei ausgetretenen Steinstufen hinauf auf die Straße nahm. Er war überzeugt, dass der Mann ihn gleich verfolgen würde.
Er entfernte sich von der Ladentür, zügigen Schrittes, aber nicht zu zügig. Alles in ihm schrie danach, loszurennen, so schnell er konnte, doch das wäre zweifellos ausgesprochen dumm gewesen. Nur sein Herz raste wie verrückt. Das Buch, das er unter der Jacke eingeklemmt trug, schien zu brennen. Auf seltsame Weise war er überzeugt, dass man es ihm ansah, ein Dieb zu sein, und zugleich, dass diese überzeugung Unsinn war, eine Stressreaktion. Er wich einer Pfütze aus. Es war kalt, kälter als heute Morgen, oder kam es ihm nur so vor, weil er schwitzte? Der graue Himmel riss auf, Sonnenlicht fiel herab wie der Strahl eines Suchscheinwerfers. Jemand hinter ihm schrie. Hendrik fuhr herum, aber es war nicht der Antiquar, sondern ein Mann in einem grünen Lodenmantel, der jemandem auf der anderen Straßenseite etwas zugerufen und gewunken hatte. Noch mehr Schweiß, der ihm kalt und klebrig den Rücken hinablief. Und Erleichterung. Verrückt, das alles. Verrückt, so etwas zu tun, für ein blödes altes Buch! |
|
Roman von Andreas Eschbach Bastei-Lübbe, Köln ISBN 978-3-7857-2568-9 Erscheint am 9. 9. 2016 |